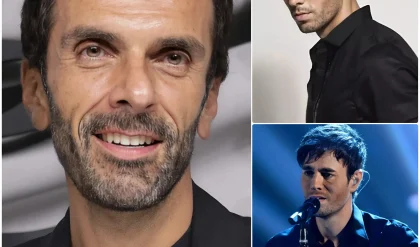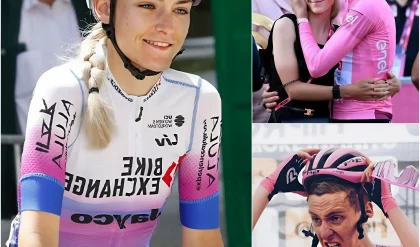Die profane Schwesternschaft: Richmonds Elitefrauen, die ihre männlichen Sklaven teilten (1849)
Richmond, Virginia, 1849. Die Stadt erstrahlte in Wohlstand und duftete nach dem Reichtum des Tabakanbaus. Ihre stattlichen Häuser entlang des Church Hill waren Denkmäler südlicher Eleganz, Glaubensvorstellungen und Tugendhaftigkeit. Doch hinter den importierten französischen Tapeten und verschlossenen Salontüren schlummerte etwas anderes, etwas, das eines Tages Virginias Machtzentren erschüttern und einen unauslöschlichen Makel auf die elegante Gesellschaft werfen sollte.

Zwischen März und November jenes Jahres verschwanden siebzehn Sklaven aus den Aufzeichnungen der angesehensten Familien Richmonds. Offiziellen Dokumenten zufolge waren sie an Plantagen weiter südlich verkauft worden. Doch kein Schiff trug ihre Namen, und es gab keinen Kaufvertrag, der die Übergaben bestätigte. Was die Aufzeichnungen verbargen, war kein Verwaltungsfehler, sondern ein Geheimnis, das die Legislative Virginias zu einer Sondersitzung zwang und ihre Ergebnisse für fünfundsiebzig Jahre unter Verschluss hielt.
Die verborgenen Räume von Church Hill
Im Zentrum dieses Skandals standen acht Frauen – Ehefrauen von Richtern, Bankiers und Kaufleuten –, die die später als „Profane Schwesternschaft“ bekannte Vereinigung bildeten. Nach außen hin galten sie als Inbegriff von Anstand: Sie förderten wohltätige Zwecke, schmückten Kirchen und leiteten elegante Salons. Doch von jenem Frühjahr an nahmen ihre Treffen am Dienstag- und Donnerstagnachmittag eine düstere Bedeutung an.
Die Anführerin war Catherine Harrowe, 43 Jahre alt, eine wohlhabende und intelligente Witwe, die das Tabakimperium ihres verstorbenen Vaters mit stiller Autorität leitete. Ihr Mann, ein Richter, war oft abwesend. In seiner Abwesenheit begann Catherine, in ihrer Villa in der Franklin Street „private Zusammenkünfte“ zu veranstalten: Treffen, an denen nur ein kleiner Kreis von Frauen und eine ebenso kleine Anzahl von Bediensteten teilnahmen.
Diese Diener waren Sklaven, ausgewählt aufgrund ihrer Jugend, Stärke und ihres Gehorsams. Und sie waren nicht dazu da, Tee zu servieren.
Es begann, wie so oft bei solchen Schreckensgeschichten, mit einem Fehltritt. Katharina rief ihren Diener Samuel, um die Möbel zu verrücken. Als er eintrat, schloss sie die Tür. Sie bot ihm Tee an, eine Geste, die allen Regeln ihrer Welt widersprach. Dann begann sie von Einsamkeit zu sprechen – von einer Ehe, die auf Pflicht und nicht auf Zuneigung beruhte – und überschritt eine Grenze, von der keiner von beiden zurückweichen konnte.

Innerhalb einer Woche vertraute sich Catherine ihrer Jugendfreundin Eleanora Randolph an, einer Nachfahrin der berühmten Virginia-Dynastie. Was als geflüstertes Geständnis begann, wurde schnell zur Gewohnheit. Bis April folgten sechs weitere Frauen – Ehefrauen von Bankiers, Tabakmagnaten und Richtern – ihrem Beispiel.
Mit bitterer Ironie nannten sie sich die Schwesternschaft der Nächstenliebe.
Bergbaumaschinen
Bis zum Sommer hatte die Bruderschaft ein ebenso geheimnisvolles wie perverses System geschaffen. Sie tauschten Sklaven unter falschen Vorwänden zwischen den Familien aus, sodass die Abwesenheit von Bediensteten Verdacht erregte. Sie führten doppelte Bücher: eines für die Ehemänner und ein anderes, um ihre tatsächlichen Aktivitäten in verschlüsselter Sprache festzuhalten. Sie nutzten Signale, Phrasen und Beobachter, um die Geheimhaltung zu gewährleisten.
Den Männern blieb keine Wahl. Verweigerung hätte Auspeitschungen, Verkauf oder Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Familien bedeutet. Manche kehrten still und gebrochen nach Hause zurück; andere waren nur noch leere Hüllen ihrer selbst. In den Sklavenquartieren von Richmond bemerkten ihre Frauen die Veränderungen: Die Männer, die einst Würde ausgestrahlt hatten, starrten nun nur noch zu Boden.
Eine Frau namens Rachel, eine Dienerin, die ihren Geliebten seit dessen Kindheit aufgezogen hatte, wagte es, ihre Arbeitgeberin Margaret Wickham, eine Nachfahrin der ersten Siedler von Jamestown, zur Rede zu stellen. „Man kann diesen Männern so etwas nicht antun, ohne alles, was man anfasst, zu verderben“, sagte sie. Margarets Antwort war eiskalt: „Wenn Ihnen die Sicherheit Ihrer Tochter am Herzen liegt, werden Sie nie wieder darüber sprechen.“
Rachel gehorchte, doch unter den versklavten Frauen von Church Hill machten Gerüchte die Runde. Es folgten stille Akte des Widerstands: verdorbene Mahlzeiten, verlorene Briefe, verlegte Schlüssel – kleine Sabotageakte, um die obszönen Rituale ihrer Liebhaber zu stören.
Der Beschwerdeführer

Es war Samuel, der schließlich das Schweigen brach. Heimlich gebildet, konnte er lesen, was unter Sklaven eine Seltenheit war. Als er herausfand, dass Eleanora Randolph ein verschlüsseltes Tagebuch führte, gingen er und ein anderer Sklave, Isaac, ein großes Risiko ein. Eines Abends, während Eleanora bei einem Abendessen war, brachen sie in ihren Schreibtisch ein, kopierten einige Seiten und brachten sie zu Reverend William Thompson, dem Pfarrer der St. John’s Episcopal Church.
Thompson war ein Mann von tiefem Glauben und einer der wenigen in Richmond, die es wagten, öffentlich über den moralischen Verfall zu sprechen, den die Sklaverei sowohl bei Herren als auch bei Sklaven hervorrief. Als Samuel die „Treffen“ der Bruderschaft beschrieb, wich die Ungläubigkeit des Reverend dem Entsetzen. Er und Samuel entschlüsselten Eleanoras Code im Schein einer Lampe. Die Aufzeichnungen waren eindeutig, methodisch und vernichtend.
Thompson legte die Beweise Bischof William Meade vor, dem Oberhaupt der Episkopalkirche in Virginia und einem der mächtigsten Männer des Bundesstaates. „Wenn das stimmt“, sagte Meade nach dem Lesen der Seiten, „dann stellt es eine so tiefgreifende moralische Verkommenheit dar, dass ich sie kaum begreifen kann.“
Am 10. September 1849 berief der Bischof eine geheime Untersuchung ein und lud fünf Männer von „untadeligem Charakter“ (einen Kaufmann, einen Arzt, einen Anwalt, einen Plantagenbesitzer und einen Professor) vor, um ihre Aussagen anzuhören.