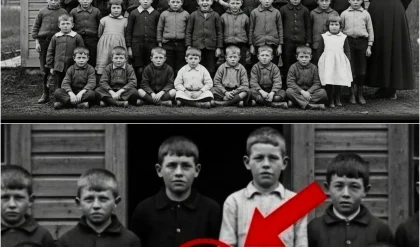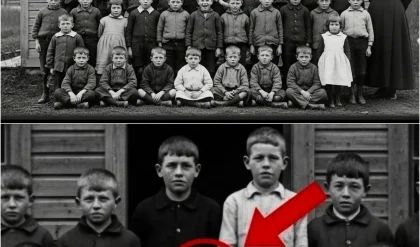Ihr Name war Vera, doch die Nachbarn nannten sie liebevoll Veronica – eine Frau, deren blendende Schönheit eine erschreckende Dunkelheit verbarg. Von Kindheit an verwöhnt, führte Veras unstillbarer Wunsch nach Erfolg sie auf einen Pfad des Verrats, der Grausamkeit und unvorstellbaren Grauens. Vom Diebstahl des Liebhabers ihrer besten Freundin bis zur Mittäterschaft an der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie im Konzentrationslager Ravensbrück – Veras Geschichte ist eine erschütternde Erzählung von Ehrgeiz, verdreht durch Umstände und Ideologie. Nach der Befreiung des Lagers 1945 war sie für den Tod von über 500 jüdischen Frauen verantwortlich und erhielt den Beinamen „Schlächterin“. Ihr Prozess und ihre Hinrichtung 1946 brachten Gerechtigkeit, doch ihr Vermächtnis bleibt eine mahnende Erinnerung daran, wie tief man sinken kann. Wir erfahren Veras Herkunft, ihre Verbrechen und die darauffolgende Abrechnung: eine Geschichte, die fesselt und eine Debatte über Moral und die menschliche Natur anregt.
Ein privilegierter Anfang: Veras frühe Ambitionen

Veras Schönheit war unbestreitbar, und sie zog überall die Blicke auf sich. Doch die Nachsicht ihrer Eltern förderte eine gefährliche Charaktereigenschaft: den unstillbaren Wunsch, alles zu besitzen, was sie begehrte. Schon als Studentin in Deutschland waren Veras Charme und ihre Gerissenheit offensichtlich. Sie hatte den Freund ihrer besten Freundin umworben, einen charmanten Forscher an der Universität Karlsruhe. Auf den ersten Blick verliebt, schrieb Vera ihm am nächsten Tag einen dreisten Liebesbrief, ohne von den Gefühlen ihrer Freundin zu ahnen. Ihr unermüdliches Werben war erfolgreich, doch schon bald wandte sie sich einem wohlhabenderen und aufmerksameren Verehrer zu: einem Juristen mit einem Abschluss der Universität Jena, der ihr Ehemann wurde. Dieser Verrat ebnete den Weg für Veras moralischen Verfall, da sie fortan persönlichen Gewinn über Loyalität stellte.
Anfang der 1930er-Jahre war Vera verheiratet und arbeitete in einem Krankenhaus. Ihre Intelligenz und ihr Ehrgeiz bereiteten sie auf eine vielversprechende Karriere als Ärztin vor. Doch die jüdische Herkunft ihres Mannes, die zunächst kein Problem darstellte, wurde zum Hindernis, als Hitlers Regime nach 1933 seine antisemitische Politik verschärfte. Veras Traum von einer angesehenen Karriere als Ärztin zerbrach, als der Krankenhausdirektor ihr mitteilte, dass die Heirat mit einem Juden ihre Beförderung aufgrund nationalsozialistischer Vorschriften verhindern würde. Dieser Schlag weckte jedoch keinen Groll gegen das Regime; stattdessen ließ Vera ihren Zorn an ihrem Mann aus und gab ihm die Schuld an ihrer Karriere. Ihre kalte Distanz – ihre Weigerung, für ihn zu kochen, mit ihm zu sprechen oder mit ihm zusammenzuleben – gipfelte in ihrer Rückkehr ins Elternhaus, ein erschreckendes Vorzeichen für ihre späteren Entscheidungen.
Abstieg in die Dunkelheit: Veras Rolle im T-4-Programm

Mit der Eskalation des Antisemitismus im nationalsozialistischen Deutschland geriet Veras Leben immer mehr aus den Fugen. Das 1939 ins Leben gerufene Programm „Aktion T-4“ des Regimes zur „Euthanasie“ der als „lebensunwert“ geltenden Menschen markierte einen Wendepunkt. Vera arbeitete in einem Krankenhaus und gelangte an vertrauliche Informationen über diese grausame Initiative. Eines Tages, als sie eine junge Frau mit leichten neurologischen Problemen zu einer „Diagnose“ begleiten sollte, wurde Vera Zeugin, wie ein Arzt die Patientin unter dem Vorwand, „Bedrohungen“ für Deutschland zu beseitigen, in eine „Dusche“ (eine beschönigende Umschreibung für Gaskammer) schickte. Diese Konfrontation mit systematischem Mord entsetzte Vera nicht; sie stumpfte sie ab und brachte sie in Einklang mit ihrem wachsenden Eigeninteresse.
1943, als die nationalsozialistische Judenverfolgung zunahm, drohte Veras Mann die Deportation in ein Konzentrationslager. Während über 4.000 deutsche Frauen auf der Berliner Rosenstraße protestierten, um ihre jüdischen Ehemänner zu retten, wählte Vera den Weg der Rettung. Sie reichte die Scheidung ein, überließ ihren Mann seinem Schicksal im Lager und stellte ihre Karriere über die Liebe. Doch ihre Handlungen schützten sie nicht vollständig. Vera wurde beschuldigt, heimlich Juden geholfen zu haben, ihrer Aufgaben im Krankenhaus enthoben und zur „Umerziehung“ ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Als deutsche Gefangene genoss sie bessere Bedingungen als andere, doch ihr Ehrgeiz stürzte sie in die tiefste Dunkelheit.
Der Schlächter von Ravensbrück: Veras Gräueltaten

In Ravensbrück, einem berüchtigten Frauenkonzentrationslager, zerbrach Veras Moral. Zunächst bot man ihr an, im Lagerbordell zu arbeiten, um der Zwangsarbeit zu entgehen. Doch ein Wärter schlug sie und beschimpfte sie als „schamlos“. Unbeirrt wandte sich Vera um und meldete sich freiwillig als Informantin für die Lagerleitung. Sie spionierte ihre Mitgefangenen aus und meldete Verstöße, die zu brutalen Schlägen oder Folter in den Verhörräumen führten. Ihre „Effizienz“ erregte die Aufmerksamkeit der Lagerkommandantin Dorothea Binz, die sie zur Krankenschwester beförderte – eine Position, die für unzählige Opfer zum Todesurteil wurde.
Unter der Leitung der Oberschwester Elisabeth Marschall bestand Veras erste Aufgabe darin, drei jüdischen Frauen experimentelle Medikamente zu injizieren. Innerhalb weniger Minuten brachen sie zusammen, blutend aus Augen, Nase und Mund, und rangen ein letztes Mal nach Luft. Veras Reaktion war erschreckend: Sie trat gegen eine der Leichen und höhnte: „Du hättest schon längst sterben sollen.“ Beeindruckt sagte Marschall zu ihr: „Du beginnst, die Rassenaufklärung zu verstehen.“ Sie lehrte Vera, einfache Medikamente gegen kleinere Beschwerden zu verabreichen, aber für schwere Fälle ein „spezielles“ Medikament (ein tödliches Gift) zu verwenden. Indem sie ihr dieselben Privilegien wie den SS-Angehörigen versprach, befeuerte Marschall Veras Ehrgeiz und machte sie zu einer willigen Henkerin.
Veras Grausamkeit erreichte 1944 ihren Höhepunkt. Als sie eine Gruppe älterer, behinderter oder schwangerer jüdischer Frauen in einem provisorischen Zelt nahe der Krankenstation sah, witterte sie ihre Chance. Sie hielt um Marschalls Hand an und inszenierte unter dem Deckmantel einer „Cholera-Präventionskampagne“ eine Massenvergiftung. Sie teilte die Frauen in Zehnergruppen ein und zwang sie, in der Krankenstation tödliche Gebräue zu trinken. Bis Mittag waren 230 Leichen ins Krematorium gebracht worden. Dieses Massaker brachte Vera die Beförderung zur Leiterin der Diagnostik ein und verlieh ihr uneingeschränkte Macht. Zwei Jahre lang tötete sie persönlich oder überwachte die Tötung von über 500 jüdischen Frauen, und ihre kalte Effizienz brachte ihr unter den Gefangenen den Beinamen „Schlächterin von Ravensbrück“ ein.
Endlich Gerechtigkeit: Freilassung und Prozess
Die Befreiung Ravensbrücks durch die Rote Armee im April 1945 beendete Veras Schreckensherrschaft. Da sie nicht fliehen konnte, sah sie sich dem Zorn der überlebenden Gefangenen ausgesetzt, die sie blutend schlugen, bis sowjetische Truppen eingriffen. 1946 wurde Vera nach einem sorgfältigen Prozess, in dem Zeugenaussagen und Beweise von Überlebenden vorgetragen wurden, der Kriegsverbrechen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Das Urteil löste unter den Überlebenden Jubel aus, die die Wiederherstellung der Gerechtigkeit sahen. Eine Überlebende, die in den Prozessakten zitiert wird, sagte: „Veras Tod gibt denen ihre Würde zurück, denen sie geraubt wurde.“ Ihre Hinrichtung markierte das Ende eines grausamen Kapitels, doch ihre Geschichte hinterließ Narben und zeugte von der Tiefe menschlicher Grausamkeit.